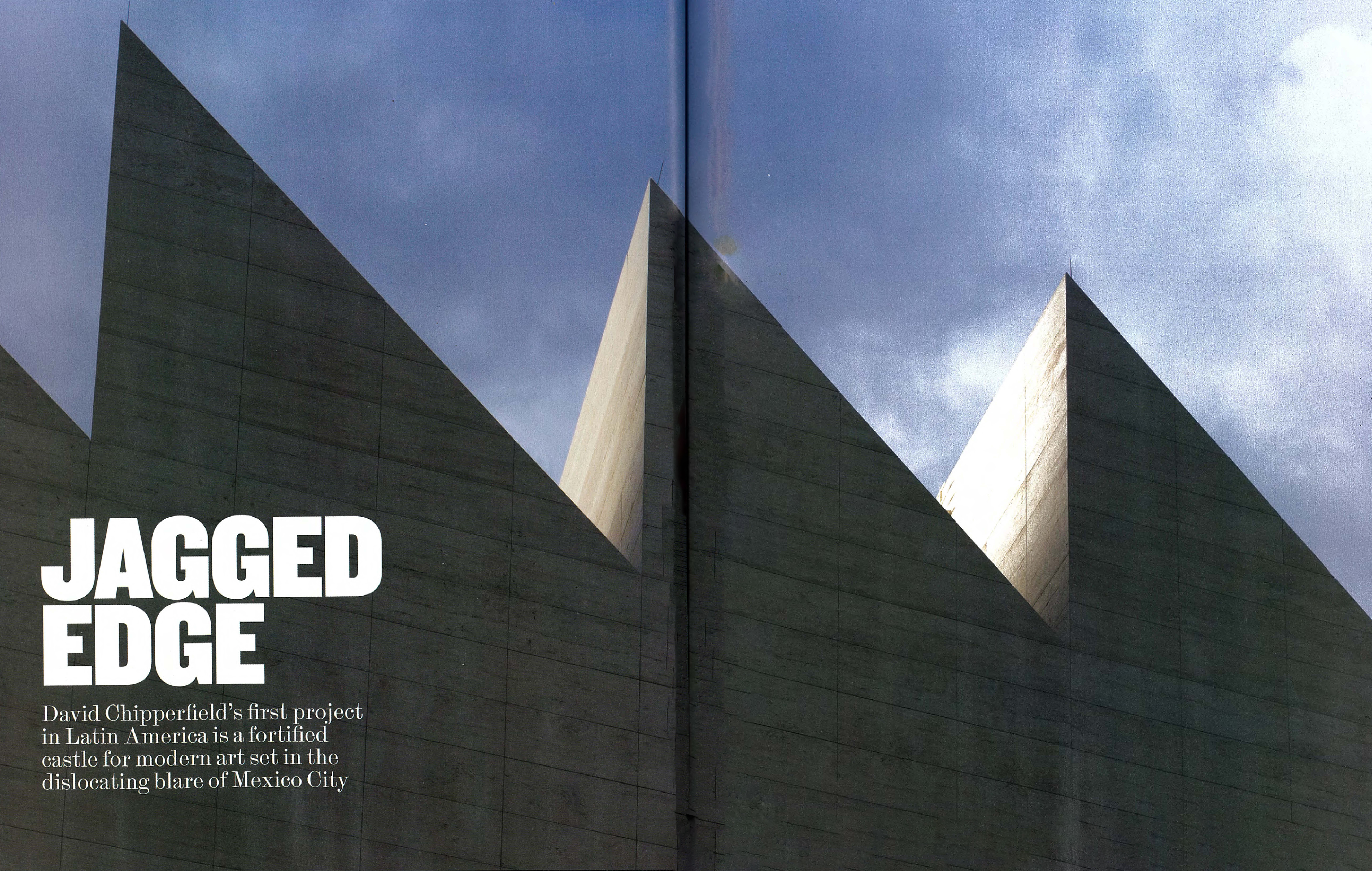Paul Smith und David Chipperfield kennen und schĂ€tzen sich schon seit Jahrzehnten. FĂŒr ICON, das Trend- und Lifestylemagazin der Welt am Sonntag, trafen sie sich zu einer Bestandsaufnahme.
Der Mann ist gefragt wie nie und baut, als gĂ€be es morgen keine FreiflĂ€chen mehr. Er hat BĂŒros in London, Berlin, Mailand und Shanghai. Die neuesten Projekte: David Chipperfield entwirft ein Museum am Rande archĂ€ologischer AusgrabungsstĂ€tten im Sudan â pro bono versteht sich. Aus New York kam zuletzt der Auftrag, den SĂŒdwestflĂŒgel des Metropolitan Museum of Art neu zu gestalten, und auch Oberursel im Taunus meldet eine Kooperation. Zusammen mit den deutschen Möbeldesignern e15 entstand unlĂ€ngst eine Reihe von HolzbĂ€nken und Tischen. Keine Frage, auch wer mit Superlativen eher knausert, wird gestehen, dass Chipperfield einer der wenigen lebenden Stararchitekten ist. In Deutschland hat er sich zudem mit dem Wiederaufbau des Neuen Museums in Berlin und der bevorstehenden Sanierung der neuen Nationalgalerie tief in die kulturelle DNA des Landes eingeschrieben. Wie gut, dass sich Paul Smith und David Chipperfield schon seit Jahrzehnten kennen und schĂ€tzen und sich deshalb fĂŒr ICON zu einer Bestandsaufnahme trafen.
Paul Smith:Â Du hast eine starke Verbindung zu Deutschland. Wie kam die zustande?
David Chipperfield: Mir war schon frĂŒh klar, dass ich im Laufe meiner Karriere viel Zeit im Flugzeug verbringen wĂŒrde. Bis heute ist es fĂŒr junge Architekten hier bei uns schwierig, mehr zu machen als eine kleine Bar, ein Interieur oder einen Hausanbau. In der Schweiz und in Deutschland bekommen junge Architekten viel mehr Möglichkeiten: Zum Beispiel einen Erweiterungsanbau fĂŒr die örtliche BĂŒcherei zu entwerfen, die Stadthalle oder ein Schwimmbad zu bauen, weil die öffentliche Hand diese AuftrĂ€ge ausschreibt. Es ist nicht alles privatisiert. Allerdings war mein erster Auftrag 1994 in Berlin, ein Privathaus zu bauen, und darauf folgte ein Studiobau in DĂŒsseldorf.
PS. Klingt nach einem guten Start.
DC. Ja, aber so richtig ging es erst mit dem Wettbewerb fĂŒr das Neue Museum los. Mitbewerber waren unter anderem Frank Gehry und Giorgio Grassi, ich war der absolute AuĂenseiter. Das war 1994 â und der Museumsdirektor wollte, dass Gehry gewinnt, was nicht der Fall war. Wir belegten damals den zweiten Platz. Dann gab es ein langes Hin- und Her und der Wettbewerb wurde schlieĂlich 1997 wiederholt â und wir gewannen! Bis zur Eröffnung im Jahr 2009 folgten dann noch einmal zwölf Jahre Planung und Bau.
PS. Unglaublich.
DC. Es war ein Projekt, das an vielen deutschen Befindlichkeiten rĂŒhrte. Vermutlich hĂ€tten wir viele Probleme vermeiden können, wenn wir das Haus einfach als Kopie wiederaufgebaut hĂ€tten. Aber ich bestand auf einer Lösung, in der die Ruine als Teil des Wiederaufbaus sichtbar sein sollte. Dieser Plan wurde Ă€uĂerst kontrovers besprochen, fiel er doch in eine Zeit, in der die Diskussionen ĂŒber den Krieg, ĂŒber Erinnerung und den Blick nach vorne in vollem Gange war. In den 80er-Jahren gab es von Seiten Deutschlands groĂe Anstrengungen, diese Themen irgendwie in Einklang zu bringen â dann fiel die Mauer in Berlin, und alles ging wieder von vorne los. Wir sagen immer, dass jede Stadt ihre Geschichte hat. Aber Berlin hat fast zu viel davon.
PS. Wie erhĂ€lt man die alten Ăberreste und schafft es, sie durch moderne Elemente schlĂŒssig zu ergĂ€nzen?
DC. Wenn ein GebĂ€ude zum Beispiel ĂŒber Nacht abbrennt, dann haben die verkohlten Ăberreste erst einmal keinen eigenen Status. Wenn jedoch ein GebĂ€ude im Krieg zerbombt wurde und dann ĂŒber 60 Jahre als Ruine dasteht, dann ist die Ruine selbst zum Zeitdokument geworden. Als wir dort hinkamen, wuchsen BĂ€ume im Inneren, es gab teilweise noch Wandbilder, andere Teile fehlten völlig. Es war wirklich ein ĂŒberwĂ€ltigender Anblick. Jeder, der diese Ruine betrat, hatte eine GĂ€nsehaut. Manchmal sind Ruinen schöner als Architektur, weil sie auf das Wesentliche reduziert sind. Und dann verputzt man alles und restauriert, und plötzlich ist der Zauber dahin. Deshalb war meine Herangehensweise, sich dem GebĂ€ude zu nĂ€hern wie einem archĂ€ologischen Objekt, beispielsweise eine beschĂ€digte altgriechische Vase oder eine römische Statue, bei denen Teile fehlten. Die wĂŒrde man auch nicht einfach erneuern und so tun, als sei das Objekt schon immer so gewesen. Man wĂŒrde es vielleicht vervollstĂ€ndigen wollen, aber dabei wĂŒrde man genau kennzeichnen, was man erneuert hat und was ursprĂŒnglich vorhanden war.
PS. Ich finde es interessant, dass du sehr viele Neubauten realisiert hast, dann aber sehr bekannt dafĂŒr wurdest, dass du Projekte verwirklicht hast, in denen sich Altes und Neues verbindet.
DC. Es gab Demonstrationen, es gab Unterschriftensammlungen fĂŒr ein Volksbegehren â ganz Deutschland wurde in diese Debatte hineingezogen. Und als das Museum dann eröffnete, waren alle mit dem sichtbaren, fassbaren Ergebnis glĂŒcklich. Der Streit löste sich in Luft auf. Angela Merkel eröffnete das GebĂ€ude und war begeistert. Und so wurde es eine Art architektonisches Symbol dafĂŒr, wie sich Geschichte in Architektur einbeziehen lĂ€sst.
PS. Wie waren die Reaktionen der Besucher?
DC. Die Leute begaben sich teilweise auf HĂ€nde und Knie, um sich die Sachen genau anzusehen, sie anzufassen. Es war herzerwĂ€rmend, ihre ZĂ€rtlichkeit gegenĂŒber den greifbaren Objekten zu sehen. Skeptiker behaupten, dass heute keiner mehr echte QualitĂ€t zu schĂ€tzen weiĂ, dass niemand sagen kann, ob ein Fisch auf dem Markt wirklich frisch ist und dass keiner gutes Material erkennt. Aber Tatsache ist, dass die Menschen sehr wohl QualitĂ€t erkennen.
PS. Mit das Schwierigste bei der Architektur â und das gilt sogar fĂŒr die Innenraumgestaltung, auch wenn ich die beiden nicht miteinander vergleichen möchte â ist, dass der Auftraggeber sich das fertige Objekt vorher nicht vorstellen kann, oder?
DC. Ich muss sagen, dass es in Deutschland ein besonderes Arbeitsklima gibt, weil man dort ĂŒber Ideen und Konzepte diskutiert. Das war auch eine der erstaunlichsten Erfahrungen: eine Gruppe von Menschen anzuleiten, die sich ĂŒber Konzepte streitet, aber dabei immer ĂŒber das Projekt spricht. Ăber Probleme im Projektmanagement mussten wir uns dagegen kaum Sorgen machen.
PS. Ich gehe davon aus, dass die Deutschen in diesen Dingen hervorragend sind.
DC. Na ja, momentan haben sie etwas Probleme: Beim Bau des neuen Berliner Flughafens gibt es enorme Verzögerungen.
PS. Wer ist dafĂŒr verantwortlich?
DC. Die Verantwortung wird herumgereicht. Momentan gibt es eine Krise in Berlin. Der Mut scheint sie irgendwie verlassen zu haben â die Staatsoper wird nicht rechtzeitig fertig, der Bau der Landesbibliothek verzögert sich. Es ist also gerade etwas schwierig.
PS. Deine Ausstellung âSticks and Stonesâ in der Neuen Nationalgalerie hingegen war ein riesiger Erfolg.
DC. Dieser Raum ist fantastisch, aber er macht einen auch fertig, denn es ist schwer, dort etwas auszustellen. Ich fĂŒhlte mich wirklich unsicher. Eine Art Retrospektive in der Neuen Nationalgalerie schien mir irgendwie seltsam. Also schlug ich vor, stattdessen etwasÂ ĂŒber Architektur zu machen. In der Zwischenzeit erhielten wir den Auftrag, das GebĂ€ude zu restaurieren, und so ergab es sich, dass unsere Ausstellung die letzte vor der SchlieĂung sein wĂŒrde. Die Neue Nationalgalerie ist eines der herausragenden GebĂ€ude in Berlin, es ist in vielerlei Hinsicht Mies van der Rohes bester Bau, er stellt einen Höhepunkt der modernen Architektur dar. AuĂen- und Innenraum gehen gewissermaĂen ineinander ĂŒber. Und ich dachte mir, dass es eine provokante Aussage wĂ€re, diesen Raum mit SĂ€ulen zu fĂŒllen â mit so vielen SĂ€ulen, wie man gebraucht hĂ€tte, wenn er 400 Jahre frĂŒher erbaut worden wĂ€re. Das ist fĂŒr mich ein spannender und ironischer Umgang mit van der Rohe, der es geschafft hatte, all diese SĂ€ulen loszuwerden. Und es ist eine rĂ€umliche, physische Erfahrung.
PS. Ich fand es toll. Es war optisch sehr eindrucksvoll. Der Raum wirkte wie ein Tempel. Mir war es etwas peinlich, denn es war wie eine Kunstinstallation. Und es ist ein bisschen sonderbar, so etwas als Architekt zu machen. Wir haben es dann damit gerechtfertigt, dass es die Abschlussausstellung war. Und natĂŒrlich hat es auch einen doppelten Sinn, denn es sah ein wenig wie ein Holz-BaugerĂŒst aus â und die Restaurierung steht ja bevor.
PS. Inwiefern gehst du anders an ein Projekt heran, wenn du weiĂt, dass sie nur temporĂ€re Installationen sind?
DC. Ich habe gemerkt, dass es fĂŒr mich dann schwieriger ist, die Idee zu entwickeln. Paradoxerweise ist unsere Beziehung zum Mies-van-der-Rohe-Bau jetzt sehr viel langfristiger geworden. Wir haben fĂŒnf Jahre, um ihn buchstĂ€blich in seine Bestandteile zu zerlegen und dann wieder so zusammenzufĂŒgen, als wĂ€re nichts gewesen.
PS. In dem Fall ist es also wirklich eine Restaurierung?
DC. Ja. Ich vergleiche es gerne mit einem alten Mercedes, Baujahr 1968. Wenn man ihn auf der StraĂe sieht, sagt man: âWow, sieh nur! Was fĂŒr ein herrlicher Wagen!â Bei nĂ€herer Betrachtung und wenn man sich reinsetzt, erkennt man dann, dass er völlig verrostet ist und die Sicherheitsgurte nicht mehr funktionieren. Um ihn fit zu machen, muss man sehr, sehr viel tun. Mit der Neuen Nationalgalerie ist es genau so: Wir mĂŒssen sie auseinandernehmen und wieder zusammenbauen, und zwar so, dass sie hinterher besser funktioniert als vorher. Dabei ist jedes einzelne Detail heilig, denn bei Mies van der Rohe dreht sich alles um die Details.
PS. Du sagtest, dass der Raum sehr schwer zu nutzen sei. Wirst du daran etwas Àndern können?
DC. Nein, daran können wir nichts Ă€ndern. In den vergangenen 47 Jahren haben sich die Menschen jedoch daran gewöhnt, den Bau so zu nutzen, wie er ist. AuĂerdem reagiert die zeitgenössische Kunst inzwischen stĂ€rker auf RĂ€ume. Heute arbeiten viele KĂŒnstler ganz ohne WĂ€nde. Sie machen zum Beispiel Klanginstallationen â Jenny Holzer hatte dort eine groĂartige Ausstellung. KĂŒnstler mögen inzwischen die Vorstellung, auf den Raum zu reagieren, also funktioniert das mittlerweile sehr gut.
PS. Wie siehst du deine eigene Rolle in Deutschland?
DC. Ich bin erst gestern von dort zurĂŒckgekommen, und das Interessante ist, dass ich inzwischen stark in diese sehr deutschen Kulturdebatten einbezogen werde. Das gefĂ€llt mir. Und ich nehme an, dass ich auch wegen des Neuen Museums heute als eine Art Geschichtsvermittler gelte. Als eingeweihter AuĂenseiter habe ich diese privilegierte Sonderstellung. Du kennst das ja â es ist vermutlich Ă€hnlich wie bei dir in Japan. Als AuslĂ€nder kann man Sachen machen, die sonst wahrscheinlich nicht möglich wĂ€ren â einfach, weil man von auĂen kommt.
PS. Ja, das kenne ich. Hier bin ich erfolgreich, aber der Grad an Respekt ist ganz anders in LĂ€ndern wie Frankreich, Italien oder Japan.
DC. Weil man hier alles nur als Teil eines Finanzsystems wahrnimmt. Darum gibt es diesen, wie ich finde, furchtbaren Begriff: âcreative industriesâ (Kultur- und Kreativwirtschaft). Wir mĂŒssen diesen Begriff hier verwenden, weil es das einzige Konzept von Kultur ist, das Politiker verstehen. Sie verstehen âKulturâ nur, wenn man den Begriff so ergĂ€nzt, dass er Möglichkeiten zum Geldverdienen suggeriert. Wenn diese Leute also ein Museum in Wakefield bauen, dann deshalb, weil sie den Standort aufwerten wollen. Und ich habe immer gesagt: âBaut nur dann ein Museum in Wakefield, wenn ihr ein Museum in Wakefield haben wollt.â Andernfalls ist es ein Desaster, denn wen interessiert ein Museum, dass nur zur Aufwertung gebaut wurde? Es wird den Standort schon aufwerten, aber man muss es auch um seiner selbst willen bauen wollen. Andernfalls geht es ein.
PS. Ich finde es spannend, dass du neben all diesen faszinierenden Projekten auch LĂ€den entwirfst.
DC. Nun, das geht auf meine AnfĂ€nge zurĂŒck. Ich habe damals das allererste LadengeschĂ€ft fĂŒr Issey Miyake entworfen.
PS. Um die Zeit haben wir uns richtig kennengelernt. Diese Art von LÀden waren oft winzig, aber wunderschön.
DC. Der erste, den ich entworfen habe, war in der Sloane Street. Das war sozusagen der Startschuss fĂŒr meine Karriere, was etwas peinlich ist.
PS. Jeder hat mal irgendwo angefangen! Mein erster Laden war dreieinhalb mal dreieinhalb Meter groà und hatte nur freitags und samstags geöffnet!
DC. Ja, aber das ist trotzdem dein KerngeschĂ€ft. Die LĂ€den â das ist nicht das, was ich eigentlich mache.
PS. Stimmt. Aber dann plötzlich fĂŒr Valentino zu arbeiten und diese wunderbaren AuftrĂ€ge fĂŒr ihn zu machen â wirklich toll.
DC. Ich denke, ich hĂ€tte nicht damit weitergemacht, wenn Valentino nicht gewesen wĂ€re â und ich muss sagen, dass Valentino einfach ein super Unternehmen ist; es macht SpaĂ, mit ihnen zu arbeiten. Als ich damals anfing, war Valentino gerade gegangen, und keiner wusste, was nach Valentino aus Valentino werden sollte. Der Umsatz war auch eingebrochen. Und irgendwie ist es mir gelungen, etwas zu entwerfen, das mit dazu beigetragen hat, sich wieder zu festigen und klar zu werden. Das war noch bevor Pierpaolo und Maria Grazia mit einstiegen. Aber nachdem sie dabei waren, wurde es noch besser. Und es ist einfach toll, mit ihnen zu arbeiten.
PS. Bei Harrods verwendest du ziemlich harte OberflĂ€chen fĂŒr die Valentino-Einrichtung.
DC. Und sie werden immer hĂ€rter, denn Valentino treibt uns immer mehr dorthin. Sie werden immer monumentaler. Interessant ist, dass es fĂŒr sie inzwischen zu einer Art MarkenidentitĂ€t geworden ist, das Strenge, Enthaltsame. Anfangs wollten sie nĂ€mlich mehr Ornamentik.
PS. Na, zum GlĂŒck ist ihre Mode ziemlich ornamental, das passt also.
DC. Ja, es funktioniert richtig gut â die Kleidung als Kontrast zu der Strenge.
PS. Was reizt dich sonst an den Laden- und Interieurprojekten?
DC. Manchmal arbeiten wir fĂŒnf Jahre an etwas, und es bewegt sich nichts vorwĂ€rts. Eine Ladeneinrichtung ist dann eine willkommene Abwechslung, denn sie wird in sechs oder neun Monaten verwirklicht. AuĂerdem kann ich an diesen Projekten ganz direkt arbeiten. Teilweise entwerfe ich jedes MöbelstĂŒck und jedes HĂ€ngesystem selbst. Als Architekt mit 200 Mitarbeitern habe ich heute sonst nicht mehr die Chance, so etwas zu tun.